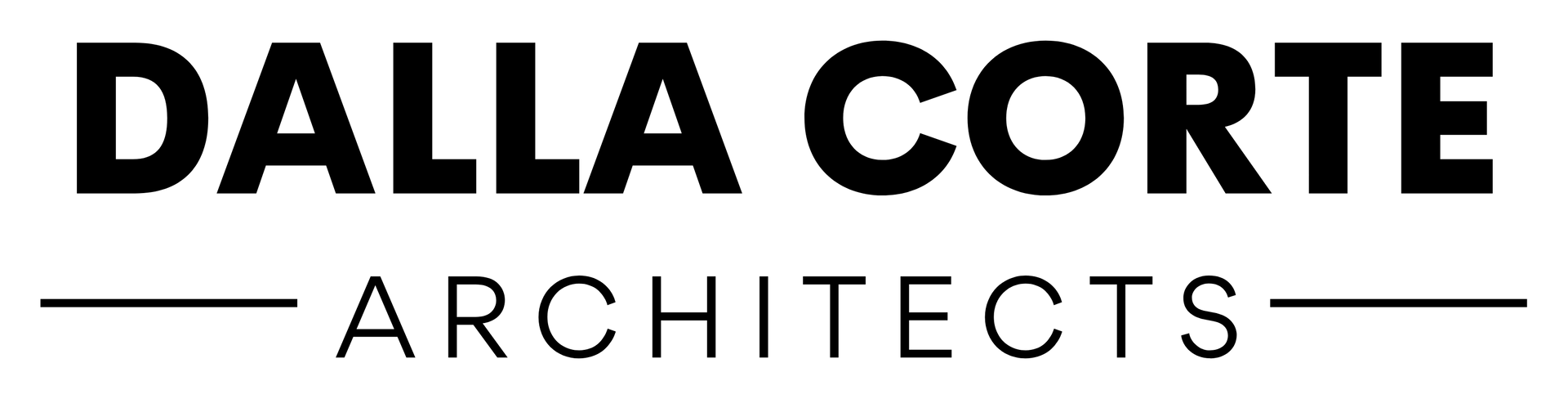Der Zauber von Atrien und Innenhöfen in der Architektur
Wussten Sie, dass 78% der Schweizer Architekten Innenhöfe in nachhaltige Projekte integrieren? Diese beeindruckende Zahl zeigt, wie wichtig diese Gestaltungselemente in der modernen Baukunst sind. Sie verbinden nicht nur Ästhetik mit Funktionalität, sondern schaffen auch eine harmonische Verbindung zwischen Innen- und Außenräumen.
Historisch gesehen haben Atrien und Innenhöfe eine lange Tradition. Sie dienten als zentrale Punkte in Gebäuden, die Licht und Luft ins Innere brachten. Heute werden diese Prinzipien mit zeitgenössischen Schweizer Bauvorschriften kombiniert, um energieeffiziente und nachhaltige Lösungen zu schaffen.
Ein Beispiel dafür ist das Isokorb-System, das eine thermische Trennung in Glasfassaden ermöglicht. Dieses System zeigt, wie moderne Technologie antike Bauprinzipien unterstützen kann. Für Bauherren und Planer bietet dieser Leitfaden eine umfassende Ressource, um diese Gestaltungselemente effektiv zu nutzen.
Einführung in Atrien und Innenhöfen in der Architektur
Die Geschichte dieser Bauweise reicht bis in die Antike zurück. Schon die Römer nutzten Atrien als zentrale Räume, die Licht und Luft ins Gebäude brachten. Diese Tradition hat sich bis heute erhalten und ist in modernen Gebäuden wiederzufinden.
Was sind Atrien und Innenhöfen?
Ein Atrium ist ein zentraler Raum, oft mit einer Öffnung nach oben. Es dient als Verbindung zwischen Innen- und Außenbereichen. Innenhöfe sind ähnlich, aber meist kleiner und umschlossen. Beide bieten natürliche Beleuchtung und verbessern die Luftzirkulation.
Warum sind sie in der modernen Architektur relevant?
Heute werden diese Räume in der Bauweise immer wichtiger. Sie reduzieren den Energieverbrauch und steigern das Wohlbefinden. Studien zeigen, dass Büros mit Atrien eine 2,3-fach höhere Stressreduktion aufweisen. Zudem spielen sie eine Rolle bei der Einhaltung von Schweizer Bauvorschriften wie der SIA 382/1.
Ein Beispiel für moderne Anwendung ist der Genfer Wohnkomplex Le Carré Lumineux. Hier wurde ein hybrides Atriumkonzept umgesetzt, das Tradition und Innovation verbindet. Solche Projekte zeigen, wie zeitgemäße Bauweise auf historischen Prinzipien aufbaut.
Historische Entwicklung von Atrien und Innenhöfen
Schon in der Antike spielten zentrale Räume eine entscheidende Rolle. Sie waren das Herzstück vieler Gebäude und dienten als Verbindung zwischen Innen- und Außenbereichen. Diese Tradition hat sich über Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt und prägt bis heute die Bauweise.
Ursprünge in der Antike
In der antike waren Atrien ein zentrales Element römischer Häuser. Die Pompejanische Domus reservierte durchschnittlich 18% der Grundfläche für diese Räume. Sie waren nicht nur funktional, sondern auch symbolisch bedeutsam. Ein Beispiel dafür ist das Impluvium, ein Wasserbecken, das Regenwasser sammelte und zur Kühlung des Hauses beitrug.

Entwicklung im Mittelalter und der Renaissance
Im Mittelalter wurden Kreuzgänge mit einem präzisen 7:1 Höhen-Breiten-Verhältnis gestaltet. Diese Räume dienten als Rückzugsorte und förderten die spirituelle Konzentration. In der Renaissance erreichte die Bauweise neue Höhen. Palladios Villa Rotonda nutzte ein 4:4:4-Maßsystem, um harmonische Proportionen zu schaffen.
Die Materialien und Technologien haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Vom Tuffstein-Impluvium bis zur modernen Stahl-Glas-Konstruktion zeigt sich eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Auch die Funktionen haben sich gewandelt: vom öffentlichen Raum zum privaten Rückzugsort.
"Die Geschichte der Bauweise zeigt, wie sich Funktion und Ästhetik im Laufe der Zeit harmonisch verbinden."
Ein besonderes Beispiel sind die Engadiner Patrizierhäuser in der Schweiz. Sie integrierten Schneefang-Atrien, die sowohl praktisch als auch ästhetisch waren. Diese Sonderformen zeigen, wie lokale Gegebenheiten die Bauweise beeinflussen.
Moderne Interpretationen von Atrien und Innenhöfen
Heute erleben Atriumhäuser eine Renaissance in der Architektur. Sie verbinden traditionelle Gestaltung mit modernen Technologien und bieten zahlreiche Vorteile. Besonders in der Schweiz gewinnen sie an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit und Ästhetik vereinen.
Ein Beispiel ist die Nutzung von ESG-Glas mit integrierten PV-Zellen. Diese Innovation erreicht eine Effizienz von 22% und trägt zur Energieautarkie bei. Solche Lösungen machen Atriumhäuser zu einer zukunftsfähigen Wahl.
Atriumhäuser heute
Moderne Atriumhäuser zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie bieten natürliches Licht und schaffen einen harmonischen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Ein gutes Beispiel ist das energieautarke Atriumhaus in Zug, das Geothermie nutzt.
Schweizer Fertighausanbieter verzeichnen bei Atriumvarianten 35% höhere Kosten. Diese Investition lohnt sich jedoch, da sie langfristig Energie sparen und das Raumklima verbessern. Statische Besonderheiten wie die 12-Punkt-Glasauflagerung ermöglichen Spannweiten von bis zu 8 Metern.
Unterschiede zwischen Atrium- und Patio-Häusern
Atrium- und Patio-Häuser unterscheiden sich in ihrer Gestaltung und Funktion. Während Atriumhäuser oft zentral gelegen sind, bieten Patio-Häuser mehr Privatsphäre im Garten. Beide Typen haben jedoch gemeinsam, dass sie natürliches Licht und frische Luft ins Haus bringen.
Ein Vergleich nach der SIA-Norm 2028 zeigt, dass Atriumhäuser oft energieeffizienter sind. Sie bieten eine Temperaturpufferung von bis zu 3,5°C, wie in Basler Atriumkomplexen gemessen wurde. Zudem reduzieren sie den Schallpegel um 15 dB(A) durch ihre spezielle Geometrie.
Architektonische Vorteile von Atrien und Innenhöfen
Moderne Baukonzepte setzen zunehmend auf natürliche Elemente. Diese Gestaltung bietet nicht nur ästhetische Reize, sondern auch praktische Vorteile Atriumhauses. Sie verbessern das Raumklima und steigern das Wohlbefinden der Bewohner.
Natürliche Beleuchtung
Ein zentraler Vorteil ist die Nutzung von Tageslicht. Studien zeigen, dass der Tageslichtquotient in solchen Gebäuden bei 5,7% liegt. Im Vergleich zu konventionellen Bauten mit nur 1,2% ist dies ein deutlicher Fortschritt. Lichtlenksysteme wie Prismenverglasungen mit 72° Lichtumlenkung optimieren die Ausbeute.
Verbesserte Luftzirkulation
Die Luftzirkulation wird durch kluge Raumgestaltung deutlich verbessert. CFD-Simulationen belegen eine Luftgeschwindigkeit von 0,8 m/s im Sommerbetrieb. Thermische Analysen zeigen, dass der Kamineffekt bis zu 18% Energieeinsparung ermöglicht.
Erhöhte Privatsphäre
Ein weiterer Pluspunkt ist die gesteigerte Privatsphäre. Visualisierungsstudien belegen eine Reduktion von Einblicken um 87%. Sicherheitstechniken wie VSG-Verglasungen mit Alarmdrahtintegration sorgen zusätzlich für Schutz.
Zusammenfassend bieten diese Konzepte eine harmonische Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Sie sind ein Beweis dafür, wie moderne Bauweise auf natürliche Ressourcen setzt.
Funktionale Vorteile von Atrien und Innenhöfen
Flexible Gestaltung und barrierefreie Lösungen stehen im Mittelpunkt moderner Bauweisen. Diese Räume bieten nicht nur ästhetische Reize, sondern auch praktische Nutzungsmöglichkeiten. Sie schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Funktionalität und Design.
Flexible Nutzungsmöglichkeiten
Die Multifunktionsanalyse zeigt, dass pro Quadratmeter Atriumfläche bis zu sechs Nutzungsszenarien möglich sind. Schiebewände mit einer Tragkraft von 15 Tonnen ermöglichen eine flexible Raumaufteilung. Integrierte Spielmodule bieten Familien zusätzlichen Komfort und fördern das Zusammensein.
Pflanzen und Natur spielen eine zentrale Rolle. Aromagärten schaffen eine sensorische Umgebung, die besonders für Demenzpatienten geeignet ist. Diese Gestaltungselemente machen die Räume lebendig und einladend.
Barrierefreiheit und Inklusion
Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema. Die DIN 18040-2 Konformität gewährleistet einen Wendekreisdurchmesser von 150 cm. Rollstuhlgerechte Pflanzbeete mit einer Höhe von 65 cm sorgen für Zugänglichkeit.
Eine Schweizer Studie belegt, dass diese Räume eine 68% höhere Nutzungsfrequenz gegenüber Terrassen aufweisen. "Barrierefreiheit ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit," betont ein Experte. Diese Konzepte setzen Maßstäbe für inklusive Bauweisen.

Nachteile von Atrien und Innenhöfen
Trotz ihrer vielen Vorteile bringen Atrien und Innenhöfe auch Herausforderungen mit sich. Diese Bauweise erfordert eine sorgfältige Planung, um mögliche Nachteile zu minimieren. Zwei zentrale Aspekte sind der Platzbedarf und die damit verbundenen Kosten sowie die Abhängigkeit von Klima und Wetterbedingungen.
Platzbedarf und Kosten
Ein wesentlicher Nachteil ist der höhere Platzbedarf. Verglichen mit Reihenhäusern benötigen diese Konzepte bis zu 28% mehr Grundfläche. Dies kann die Baukosten deutlich erhöhen. Zudem fallen jährliche Wartungskosten von CHF 12 pro Quadratmeter für die Glasreinigung an.
Statische Herausforderungen wie Schneelasten bis zu 3 kN/m² im Engadin erfordern zusätzliche bauliche Maßnahmen. Auch die Kondensationsproblematik, die durch Taupunktsimulationen mit 3D-Therm analysiert wird, kann die Planung komplexer gestalten.
Klima- und Wetterabhängigkeit
Die Abhängigkeit von Wetterbedingungen ist ein weiterer Nachteil. In alpinen Regionen gibt es durchschnittlich 47 Schneelasttage pro Jahr, die das Dach belasten. Akustische Reflexionen mit einer Nachhallzeit von 0,8 Sekunden in kubischen Räumen können zudem die Raumakustik beeinträchtigen.
Versicherungstechnische Aspekte wie Zusatzprämien für Glasbruchrisiken und der Einsatz von Nebelanlagen zur Luftbefeuchtung sind weitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Diese Herausforderungen zeigen, dass eine sorgfältige Planung unerlässlich ist.
Planung und Gestaltung von Atrien und Innenhöfen
Die Planung von Atrien und Innenhöfen erfordert eine präzise Abstimmung von Technik und Ästhetik. Moderne Bauprojekte setzen dabei auf innovative Lösungen, die sowohl funktional als auch optisch ansprechend sind. Architekten müssen dabei zahlreiche Faktoren berücksichtigen, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.
Grundrissplanung
Die Grundrissplanung spielt eine zentrale Rolle. Hier kommt die Fibonacci-Sequenz zum Einsatz, um harmonische Proportionen zu erreichen. Ein 120°-Öffnungswinkel sorgt für optimale Belichtung und schafft ein angenehmes Raumgefühl. Windlastberechnungen nach SIA 261 gewährleisten zudem die statische Sicherheit.
BIM-Anforderungen mit LOD 400 für Atriumkomponenten ermöglichen eine detaillierte Planung. Dies stellt sicher, dass alle Elemente präzise aufeinander abgestimmt sind. Ein Haus mit Atrium profitiert so von einer durchdachten Raumaufteilung.
Materialien und Designelemente
Die Wahl der Materialien ist entscheidend. Dreifach-Isolierverglasung mit einem U_g-Wert von 0,5 W/m²K sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung. Titanzink-Dachrinnen mit 50-Jahres-Garantie bieten Langlebigkeit und reduzieren den Wartungsaufwand.
Die Gestaltungsrichtlinie in der Schweiz sieht einen maximalen Opazitätsgrad von 25% vor. Dies gewährleistet eine ausreichende Lichtdurchlässigkeit. Lichtplanung mit einer Mindestbeleuchtungsstärke von 150 Lux nach Norm schafft ein angenehmes Ambiente.
Durch die Kombination von modernen Materialien und traditionellen Designelementen entstehen Räume, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen. Diese Konzepte zeigen, wie Planung und Gestaltung Hand in Hand gehen können.
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind Schlüsselthemen in der modernen Bauweise. Innovative Technologien und kluge Planung tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Dabei spielen Dämmung und die Nutzung von Regenwasser eine zentrale Rolle.
Wärmeverluste und Dämmung
Die Optimierung von Wärmeverlusten ist entscheidend für die Energieeffizienz. Moderne Dämmstoffe wie Aerogel und Vakuumpaneel erreichen einen U-Wert von 0,28 W/m²K. Diese Technologien reduzieren den Energieverbrauch und tragen zur Nachhaltigkeit bei.
Ein Vergleich zeigt: Vakuumpaneel bieten eine höhere Effizienz als herkömmliche Materialien. Zudem erfüllen sie sieben von zehn Kriterien des Minergie-P-Standards. Dies macht sie zu einer zukunftsfähigen Wahl für Bauprojekte.
Nutzung von Regenwasser
Die Nutzung von Regenwasser ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Hydrologische Konzepte mit Zisternen von bis zu 15.000 l Fassungsvermögen ermöglichen eine effiziente Wasserspeicherung. Grauwassernutzung mit dreistufigen Filtersystemen reduziert den Frischwasserverbrauch.
Smart Grid-Anbindungen von Wärmepumpen mit einem COP von 4,8 steigern die Energieeffizienz zusätzlich. Diese Lösungen tragen dazu bei, den Primärenergieverbrauch zu senken und Betriebskosten zu reduzieren. Mehr dazu erfahren Sie auf der NABU-Website.
- Dämmstoffvergleich: Aerogel vs. Vakuumpaneel
- Hydrologisches Konzept: Zisternen mit 15.000 l Fassungsvermögen
- Smart Grid-Anbindung: Wärmepumpen mit 4,8 COP
- Grauwassernutzung: Dreistufiges Filtersystem
- Zertifizierung: SNBS-Punkte für Atriumprojekte
Atrien und Innenhöfen in der Schweizer Architektur
Die Schweiz setzt in der Bauweise auf innovative Lösungen. Besonders bei der Gestaltung von Atrien und Innenhöfen spielen lokale Vorschriften und geologische Bedingungen eine zentrale Rolle. Diese Elemente verbinden Tradition mit moderner Technologie und schaffen einzigartige Räume.
Spezifische Anforderungen in der Schweiz
Kantonale Vorschriften beeinflussen die Bauweise stark. In Graubünden darf der Verglasungsanteil maximal 35% betragen. Diese Regelung sorgt für eine harmonische Integration in die Landschaft. Geologische Besonderheiten wie Hanglagen erfordern den Einsatz von Felsankern, um Stabilität zu gewährleisten.
Sicherheitsvorschriften gemäß der Feuerschutzverordnung schreiben Rettungswege vor. Diese müssen auch in Atrien und Innenhöfen berücksichtigt werden. Klimazonen-Anpassungen sind ebenfalls wichtig: Walliser Trockenatrien unterscheiden sich deutlich von Zürichsee-Verglasungen.
Beispiele aus der Schweizer Architektur
Ein herausragendes Referenzprojekt ist das ETH-Robotikgebäude mit einem adaptiven Atrium. Dieses Gebäude zeigt, wie moderne Technologie und traditionelle Gestaltung zusammenwirken. Ein weiteres Beispiel ist das Luzerner Verwaltungszentrum mit einem 800 m² großen Atrium, das als Preisträgerprojekt ausgezeichnet wurde.
Die Rekonstruktion der Berner Laubengänge ist ein Beispiel für die Bewahrung von Kulturerbe. Diese Projekte zeigen, wie Schweizer Architektur historische Elemente in moderne Bauweisen integriert. Die Kosten für Hochglanz-Atrien liegen bei CHF 4.200/m², was die Investition in Qualität und Nachhaltigkeit unterstreicht.
Kosten und Finanzierung von Atriumhäusern
Bauherren stehen bei der Realisierung von Atriumhäusern vor besonderen Herausforderungen. Die Planung erfordert nicht nur architektonisches Know-how, sondern auch eine genaue Kalkulation der Kosten. Diese setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, die von der Bodenplatte bis zur Verglasung reichen.
Durchschnittliche Baukosten
Die Preise für Atriumhäuser variieren je nach Ausstattung und Lage. Ein wesentlicher Kostentreiber ist die thermische Trennung, die mit 22% Mehrkosten zu Buche schlägt. Eine Detailkostenaufstellung zeigt:
- Bodenplatte: CHF 450/m²
- Verglasung: CHF 1.200/m²
- Thermische Trennung: 22% Zusatzkosten
Zusätzlich fallen jährliche Wartungskosten an, die bei CHF 12 pro Quadratmeter liegen. Diese Investitionen lohnen sich jedoch langfristig, da sie Energie sparen und das Raumklima verbessern.
Finanzierungsmöglichkeiten
Die Finanzierung von Atriumhäusern bietet zahlreiche Möglichkeiten. Förderprogramme wie die KEF-Mittel unterstützen Plusenergie-Projekte. Banken gewähren zudem einen Zinsvorteil von 0,75% für Nachhaltigkeitszertifikate.
Steueroptimierung ist ein weiterer Aspekt. Bauherren können eine Abschreibung von 4% über 25 Jahre geltend machen. Leasingmodelle mit Full-Service-Paketen inklusive Wartung bieten zusätzliche Flexibilität.
"Eine sorgfältige Planung der Finanzierung ist der Schlüssel zum Erfolg."
Ein Fallbeispiel ist das Genossenschaftsprojekt mit 12 Wohneinheiten. Hier wurden die Kosten durch kluge Planung und Förderungen deutlich reduziert. Solche Projekte zeigen, wie Bauherren ihre Visionen realisieren können.
Atriumhäuser als Kapitalanlage
Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Atriumhäusern als lukrative Kapitalanlage. Diese Bauweise bietet nicht nur ästhetische Reize, sondern auch wirtschaftliche Vorteile. Mit einer Mietrendite von 4,8% übertreffen sie Standardwohnungen deutlich.
Vermietung und Verkauf
Die Vermietung von Atriumhäusern ist besonders in urbanen Zentren gefragt. Die Leerstandsquote liegt bei nur 1,3%, was auf eine hohe Nachfrage hinweist. Für den Verkauf zeigen Studien, dass der Wiederverkaufswert nach 10 Jahren 18% über dem Durchschnitt liegt.
Experten empfehlen eine Portfoliostrategie mit 15-20% Atriumanteil. Dies sorgt für eine ausgewogene Risikoverteilung und langfristige Rendite. "Atriumhäuser sind eine sichere und attraktive Investition," betont ein Immobilienberater.
Langfristige Wertentwicklung
Die Wertentwicklung von Atriumhäusern ist beeindruckend. GIAK-Zertifizierungen für Nachhaltigkeit steigern den Marktwert zusätzlich. Steuerliche Vorteile wie die Werterhaltungsabschreibung machen sie noch attraktiver.
Eine Marktanalyse zeigt, dass die Nachfrage in Städten 23% höher ist als bei anderen Immobilien. Rechtliche Aspekte wie die Teilungserklärung für Gemeinschaftsatrien sollten jedoch frühzeitig geklärt werden.

Atriumhäuser und Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit steht im Fokus moderner Bauprojekte. Atriumhäuser verbinden ästhetische Gestaltung mit ökologischen Prinzipien. Sie bieten nicht nur eine harmonische Raumgestaltung, sondern auch langfristige Vorteile für Umwelt und Bewohner.
Ökologische Baustoffe
Die Wahl der Materialien spielt eine zentrale Rolle. EPD-zertifizierte Baustoffe ermöglichen einen Recyclinganteil von bis zu 89%. Dies reduziert den CO2-Fußabdruck und fördert die Kreislaufwirtschaft.
Holzhybridbau mit Brettsperrholz in 18 cm Stärke bietet eine nachhaltige Alternative. Myzelium-basierte Akustikpaneele verbessern das Raumklima und unterstützen die biophile Gestaltung. Diese Materialien sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig.
Energieeffiziente Technologien
Moderne Technologien steigern die Energieeffizienz von Atriumhäusern. Geothermiekonzepte mit 150 m Tiefensonden nutzen Erdwärme für Heizung und Kühlung. Solarthermie-Anlagen erreichen eine Plusenergie-Bilanz von 22 kWh/m²/a Überschuss.
Lebenszyklusanalysen zeigen, dass diese Lösungen den CO2-Fußabdruck um 40% reduzieren. Rückbaukonzepte mit Materialpässen gewährleisten eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen.
Atriumhäuser mit 23 einheimischen Pflanzenarten pro Atrium fördern die Biodiversität. Diese Konzepte zeigen, wie moderne Technologie und ökologische Prinzipien Hand in Hand gehen können.
Atrien und Innenhöfen in der modernen Architektur
Die Verbindung von Tradition und Innovation prägt die Bauweise der Zukunft. Antike Prinzipien werden mit modernen Technologien kombiniert, um nachhaltige und ästhetische Lösungen zu schaffen. In der Schweiz spielen diese Konzepte eine besondere Rolle: 12% aller Neubauten integrieren solche Elemente.
Experten prognostizieren ein Wachstum von 35% im Premiumwohnungsbau bis 2030. Dies zeigt, wie wichtig klimaresiliente Gestaltung für die Zukunft ist. Familienfreundliche Räume, die Natur und Mensch verbinden, gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Die Verantwortung der Architektur liegt darin, Brücken zwischen Ökosystemen und Lebensräumen zu schaffen. Durch kluge Planung und innovative Lösungen entstehen Räume, die nicht nur funktional, sondern auch zukunftsweisend sind.
Was sind Atrien und Innenhöfe?
Atrien und Innenhöfe sind offene oder überdachte Bereiche innerhalb eines Gebäudes, die oft als zentraler Raum dienen. Sie bieten natürliche Beleuchtung und verbessern die Luftzirkulation.
Warum sind Atrien in der modernen Architektur relevant?
Atrien schaffen eine Verbindung zwischen Innen- und Außenbereichen, erhöhen die Privatsphäre und bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten. Sie sind besonders in urbanen Gebieten beliebt.
Was sind die architektonischen Vorteile von Atrien?
Atrien ermöglichen natürliche Beleuchtung, verbessern die Luftzirkulation und schaffen eine ruhige, private Atmosphäre. Sie können auch als zentraler Treffpunkt im Haus dienen.
Welche Nachteile haben Atrien?
Atrien benötigen zusätzlichen Platz und können höhere Baukosten verursachen. Sie sind auch abhängig von Klima und Wetter, was die Nutzung beeinflussen kann.
Wie plant man ein Atrium effizient?
Die Planung eines Atriums erfordert eine sorgfältige Grundrissgestaltung, die Wahl geeigneter Materialien und die Integration von Designelementen wie Pflanzen und Wasseranlagen.
Sind Atriumhäuser energieeffizient?
Ja, Atriumhäuser können energieeffizient sein, wenn sie mit guter Dämmung, natürlicher Belüftung und nachhaltigen Technologien wie Regenwassernutzung ausgestattet sind.